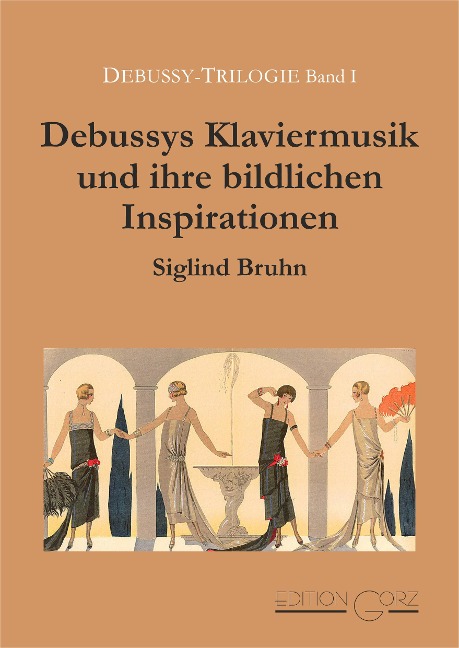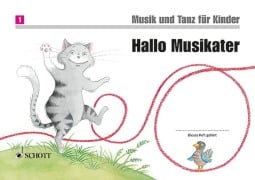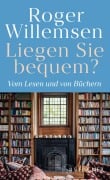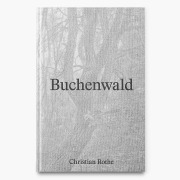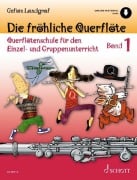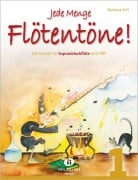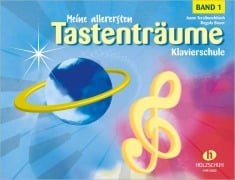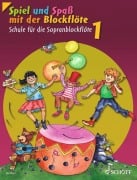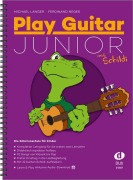Debussys Klaviermusik, entstanden in der Hauptsache zwischen 1888 und 1915, umfasst 14 Zyklen und 25 Einzelstücke. 29 der Werke gehören zum Solorepertoire, weitere 10 sind für zwei Pianisten an einem oder zwei Instrumenten komponiert. Hinsichtlich ihrer Aufführungsdauer von zwei bis sechs Minuten könnte man von Miniaturen sprechen; doch machen fast alle dieser kurzen Stücke vollgültige Aussagen. Schon die Titelgebung ist faszinierend. Neben Bezeichnungen, die auf Tänze oder Charakterstücke verweisen - Menuet, Passepied, Sarabande, Cortège, Mazurka, Tarentelle, Valse, Nocturne, Berceuse, Élégie etc. - sind viele der einzeln stehenden oder als Teil eines Zyklus konzipierten Stücke durch das Zitat einer Gedichtzeile oder Bildunterschrift oder durch eine programmatische Assoziation Debussys gekennzeichnet. Der wollte die verbalen Zusätze allerdings nicht immer als Titel im traditionellen Sinne verstanden wissen. In den Préludes z.B. gehen sie der Musik nicht voraus, sondern stehen unter dem letzten Notensystem, in Klammern und nach vorausgehenden Auslassungszeichen. Dies hat einige Interpreten veranlasst zu vermuten, Debussy habe zunächst die Musik geschrieben und erst von der schon fertigen Komposition die Anregung für ein Bild oder eine poetische Idee empfangen.
Die Reihenfolge der Entstehung von Musik und Titelzeile mag im Einzelfall nicht immer zu klären sein, doch erlauben viele der verbalen Zusätze wichtige Einsichten in die außermusikalischen Inspirationen, die Debussys Kunstverständnis bestimmen. Betrachtet man seine häufigen Anspielungen auf gemalte oder gezeichnete, im Raum gestaltete oder poetisch evozierte Bilder im Kontext der thematischen Komponenten sowie der Semantik und Struktur seiner Musik, mit Gespür für die unterschiedlichen Blickwinkel in der außermusikalischen Assoziation einerseits und der Musik andererseits, so entdeckt man interpretatorisch bedeutsame und häufig bezaubernde Beziehungen.
Im Paris des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts fanden Debussy und seine Komponistenkollegen eine künstlerische Atmosphäre vor, die wesentlich durch einige Dichter bestimmt wurde, die sich regelmäßig an Orten wie dem berühmten Chat Noir trafen. Nach Paul Dukas konzipierten diese Dichter ihre Texte wie Musiker oder Maler: "Verlaine, Mallarmé, Laforgue brachten uns neue Töne, neue Klänge. Sie projizierten bisher nie gesehene Lichter auf die Wörter; sie verwendeten Methoden, die ihren Vorgängern unbekannt waren; sie schufen mit der Satzstruktur Effekte von einer Subtilität oder Kraft, die man nicht für möglich gehalten hätte." Debussy, der mit mehreren dieser Dichter befreundet war, teilte auch ihre Begeisterung für die Ausstellungen zeitgenössischer Künstler und die Darbietungen außereuropäischer Kunst. Er sammelte, was er sich mit seinen begrenzten finanziellen Mitteln leisten konnte, insbesondere Drucke. Viele sind heute zu besichtigen im "Maison natale Claude Debussy" in Saint-Germain-en-Laye, dem in seinem Geburtshaus errichteten Museum.
Das vorliegende Buch, Band I einer Trilogie zum Werk von Claude Debussy, widmet sich in chronologischer Anordnung dessen größeren Klavierwerken, mit besonderem Augenmerk auf deren außermusikalische Inspirationen. Dazu gehören im Bereich der bildenden Kunst Farbholzschnitte und Lackarbeiten sowie Skulpturen aus dem asiatischen und dem mediterranen Raum, Ölgemälde und Drucke aus Frankreich, Radierungen aus Spanien und kolorierte Zeichnungen aus England. Im Bereich der Poesie ließ Debussy sich vor allem von Texten französischer Zeitgenossen anregen, jedoch auch von Märchen.
Siglind Bruhn, geboren in Hamburg, studierte das künstlerische Hauptfach Klavier (Staatsexamen Musikhochschule Stuttgart, Meisterklasse Wladimir Horbowski) sowie vergleichende Literaturwissenschaft und Philosophie (Magister Artium, Universität München), bevor sie 1985 an der Universität Wien in Musikanalytik promovierte.
Nach Lehrtätigkeit in Deutschland und an der University of Hong Kong arbeitet sie seit 1993 als Life Research Associate am Geisteswissenschaftlichen Forschungsinstitut der University of Michigan/USA. Ihre Recherchen konzentrieren sich auf die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, insbesondere in deren Beziehungen zu Dichtung, bildender Kunst und Religion. Ihre Veröffentlichungen umfassen mehr als 25 Buchmonografien sowie fünf Anthologien. Als Herausgeberin betreut sie zudem die bei Pendragon Press / New York erscheinende Buchreihe "Interplay: Music in Interdisciplinary Dialogue".
2001 wurde sie in die Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste gewählt, 2008 verlieh ihr die Linnaeus-Universität in Schweden die Ehrendoktorwürde. Für die Jahre 2014-2017 hat sie eine Einladung zu einer Gastprofessur an den Musikakademien in Krakau und Katowice, Polen, angenommen.
Buchpublikationen (deutsch):
* Buchtrilogie zum Werk von Claude Debussy
Band I: Debussys Klaviermusik und ihre bildlichen Inspirationen (2017)]
* Henri Dutilleux. Jede Note auf der Goldwaage gewogen (2016)
* Aribert Reimanns Vokalmusik (2016)
* Schönbergs Musik 1899-1914 im Spiegel des kulturellen Umbruchs (2015)
* Europas klingende Bilder. Eine musikalische Reise (2013)
* Die Musik von Jörg Widmann (2013)
* Buchtrilogie zum Schaffen Paul Hindemiths
Band III Hindemiths große Instrumentalwerke (2012),
Band II Hindemiths große Vokalwerke (2010)
Band I Hindemiths große Bühnenwerke (2009)
* Buchtrilogie zur musikalischen Symbolsprache Olivier Messiaens
Band III Messiaens 'Summa theologica'. Musikalische Spurensuche mit Thomas von Aquin
in "La Transfiguration", "Méditations" und "Saint François d'Assise" (2008)
Band II Olivier Messiaen, Troubadour. Liebesverständnis und musikalische Symbolik
in "Poèmes pour Mi", "Chants de terre et de ciel", "Trois petites Liturgies de la présence divine",
"Harawi", "Turangalîla-Sinfonie" und "Cinq Rechants" (2007)
Band I Messiaens musikalische Sprache des Glaubens. Theologische Symbolik in den Klavierzyklen
"Visions de l'Amen" und "Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus" (2006)
* J. S. Bachs Wohltemperiertes Klavier. Analyse und Gestaltung (2006)
* Christus als Opernheld im späten 20. Jahrhundert (2005)
* Das tönende Museum. Musik des 20. Jahrhunderts interpretiert Werke bildender Kunst (2004)
* Die musikalische Darstellung psychologischer Wirklichkeit in Alban Bergs Wozzeck (1986)
* Die Kunst musikalischer Gestaltung am Klavier. Gestaltungskriterien und Gestaltungsmittel in Bach'scher und klassischer Klaviermusik (1981)
Auswahl englisch:
* Frank Martin's Musical Reflections on Death (2011)
* The Musical Order of the World: Kepler, Hesse, Hindemith (2005)
* Saints in the Limelight: Representations of the Religious Quest on the Post-1945 Operatic Stage (2003)
* Musical Ekphrasis: Composers Responding to Poetry and Painting (2000)
* Musical Ekphrasis in Rilke's Marienleben (2000)
 Und dann auf "Zum Home-Bildschirm [+]".
Und dann auf "Zum Home-Bildschirm [+]".