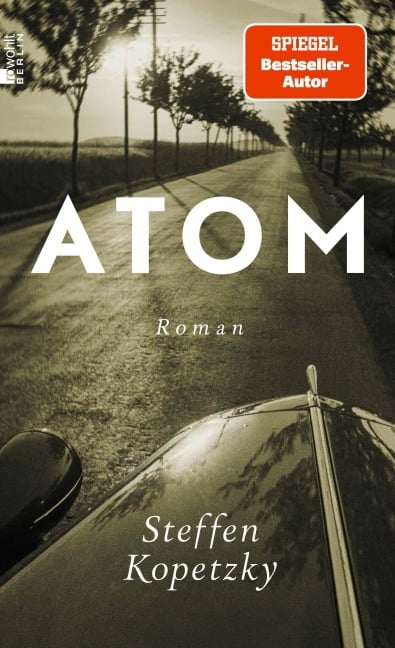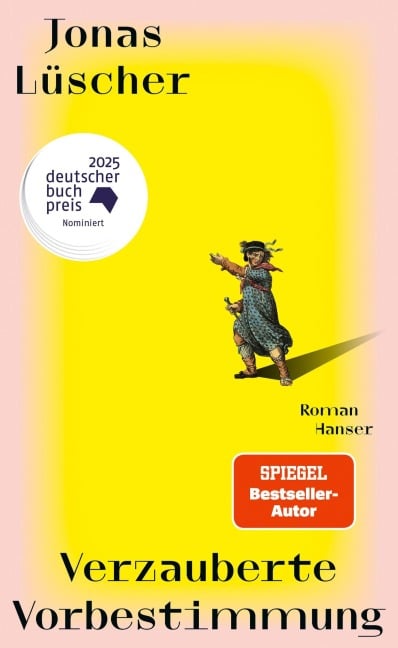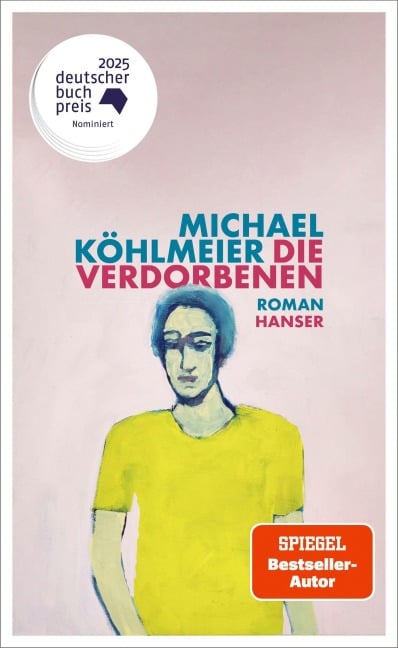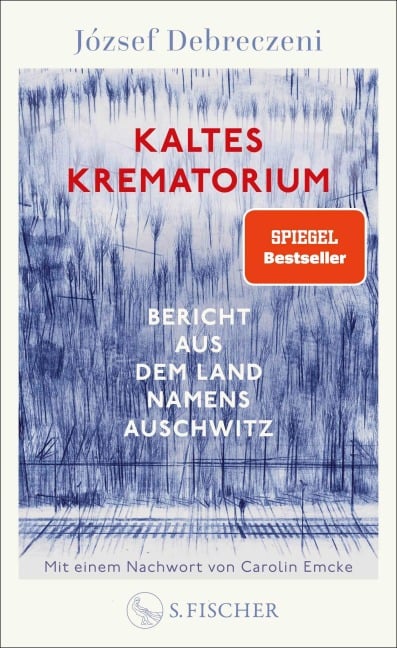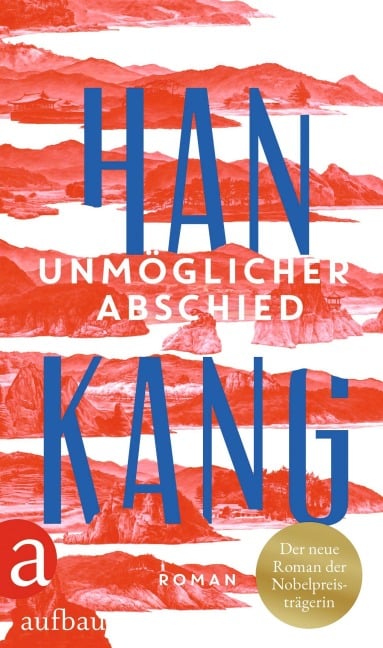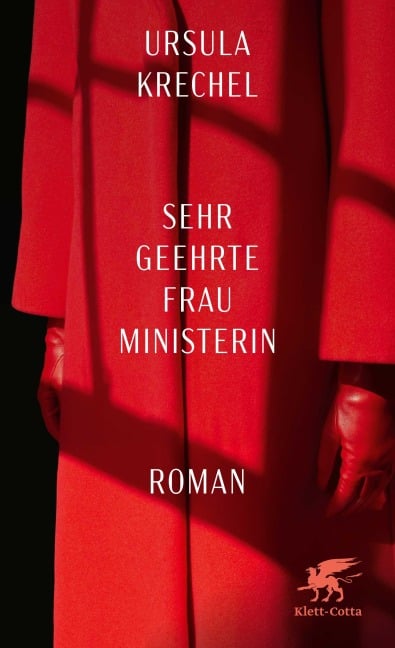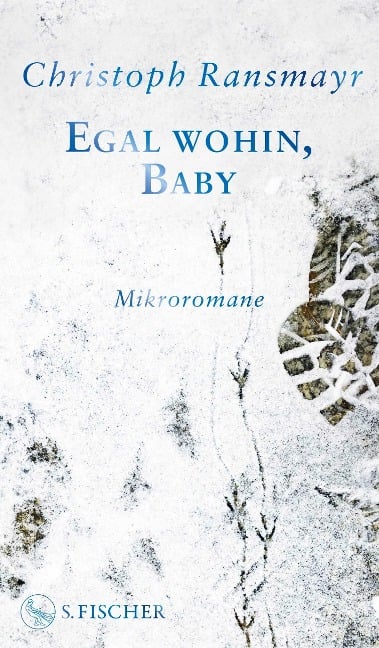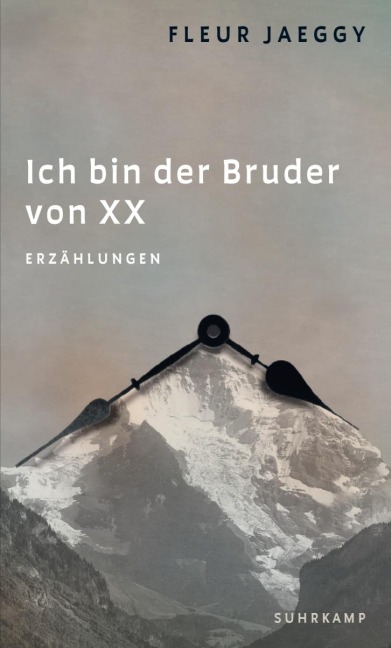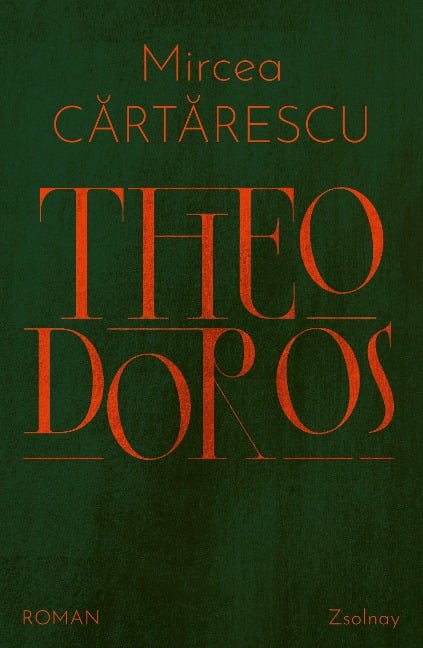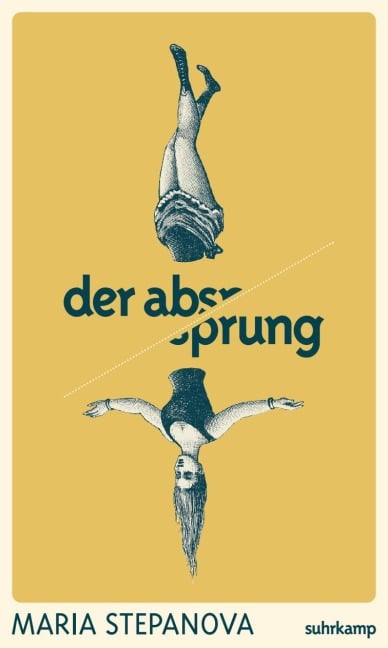Theodoros Mircea Cartarescu
Buch (Hardcover)
„Der vielleicht verstörendste und großartigste Roman-Brocken der Saison“ (Frank Dietschreit, rbb Radio 3) von einem Autor, der in jeder Rezension als heißer Kandidat für den Nobelpreis gehandelt wird.
Der Theodoros des Romans ist eine historische Figur und er ist es nicht. Als Thewodros II. war er von 1855 bis 1868 Kaiser von Äthiopien, anfangs mit den Briten verbündet, nachdem er aber als Reaktion darauf, dass Königin Victoria seine Briefe und Hilfsersuchen nicht beantwortete, europäische Geiseln nahm, wurde er zum Ziel einer groß angelegten Rachemission des britischen Weltreiches und nahm sich – angeblich mit einer ihm von Königin Victoria geschenkten Pistole – das Leben, als die Briten seine Festung Magdala eroberten. Cartarescu zitiert in seinem Nachwort einen Brief des rumänischen Politikers und Revolutionärs Ion Ghaci aus dem Jahr 1883, in dem dieser die Vermutung aufgestellt hat, bei Thewodros II. handele es sich um den vom Hof seines (Ghacis) Vaters geflohenen Sohn eines Dieners: „Diese Annahme hat keine reale historische Grundlage, aber sie eröffnet die faszinierende Perspektive einer kontrafaktualen, fiktionalen, mythischen und archetypischen Geschichte“ (Cartarescu).
So schildert uns Cartarescu den Lebensweg von Tudor, dem Sohn einer griechischen Magd und eines rumänischen Vaters, der auf einem Bojarengut in der rumänischen Walachei aufwächst, sich später Räuberbanden anschließt, zum gefürchteten Piraten Theodoros in der Adria und Ägäis wird und schließlich aufgrund eines heimtückischen Identitätstausches zum Kaiser vom Äthiopien wird. Mythisch ist die Erzählung u.a., weil Theodoros zeitlebens nach der Bundeslade sucht und weil in einer grandiosen Parallelmontage die Geschichte von König Salomon und der Königin von Saba und ihres Sohnes Menelik erzählt wird, eine Nacherzählung biblischer Motive, wie man sie seit Thomas Manns Josef-Roman nicht mehr gelesen hat. Nebenbei erzählt der Roman die Geschichte des (Ost-)Christentums und der äthiopischen Kirche und ist voller nacherzählter Märchen und Mythen der rumänischen Tradition. Archetypisch ist der Roman, weil er eine „Studie darüber (ist), wie jemand mit hoffungsvollen Anfängen zum blutrünstigen Despoten wird“ (Christiane Pöhlmann, FAZ).
Erzählt wird die Geschichte von Theodoros in der zweiten Person Singular, Erzählinstanz ist niemand geringeres als die sieben Erzengel, die sich an Theodoros, aber zugleich an den Herrn des jüngsten Gerichts wenden. Cartarescu nennt das Buch sein „Lebensprojekt“, das ihn seit vierzig Jahren beschäftigt habe: „Erst jetzt, in einer Zeit der Depressionen, Konfusionen, Pandemien und Kriege, als ginge es mit der Welt zu Ende, habe ich schließlich die zwei Jahre gefunden, in denen ich, um zu überleben, Theodoros geschrieben habe.“
„Theodoros“ ist poetisch, sinnlich, erotisch, gewalttätig und in einer großartigen Sprache geschrieben, voller übernatürlicher Episoden in der Tradition des magischen Realismus.. Kein Pageturner, aber eine fesselnde Lektüre für lange Winterabende und ein großes Lesevergnügen. Unisono rühmen die Rezensenten die „grandiose“ (FAZ), „glänzende“ (Tagesspiegel) bzw. „makellose“ (SZ) Übersetzung von Ernest Wichner.
„Es kann“, schreibt Cartarescu „in Gesichten, Träumen und Irrsinn, in Märchen und Phantasmen mehr Wahrheit stecken als in den Lieben und Schlachten der wirklichen Welt.“ Und so erzählt uns dieser nur scheinbar aus der Zeit gefallene Roman Geschichten voller Wahrheit über unsere Welt – große Weltliteratur auch ohne Nobelpreis.
"Theodoros" ist Mircea Cartarescus neuer, literarischer und epochaler Roman - nach "Solenoid" geht er auch hier "aufs Ganze" (Burkhard Müller, Die Zeit).
Der Kaiser der Kaiser Afrikas, die englische Königin Victoria, Tudor, ein wissbegieriges Kind, die Königin von Saba: In 33 Kapiteln verschränkt Cartarescu Historisches, Phantastisches, Philosophisches mit schrecklich-schönen Abenteuergeschichten zu nichts weniger als einem Weltganzen, das bis in unsere Zeiten, bis zum Jüngsten Gericht reicht.
"Den Pistolenlauf noch im Mund, das Hirn verstreut auf dem roten Tisch." Ehe die britische Kolonialarmee die Bergfestung Magdala in Schutt und Asche legt und ihn als Geisel nimmt, setzt der äthiopische Kaiser am Ostersonntag des Jahres 1868 seinem Leben ein Ende. Nicht als gekrönter Despot, nicht als plündernder Seeräuber, sondern als Bojarendiener aus der Walachei, heißt es in Mircea Cartarescus neuem epochalen Roman.
zum Produkt
€ 38,00*
 Und dann auf "Zum Home-Bildschirm [+]".
Und dann auf "Zum Home-Bildschirm [+]".