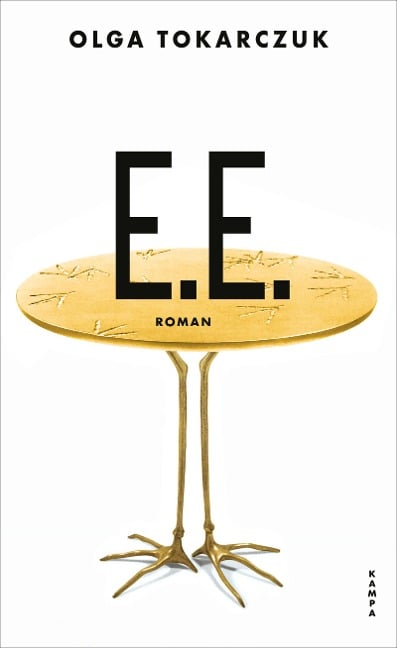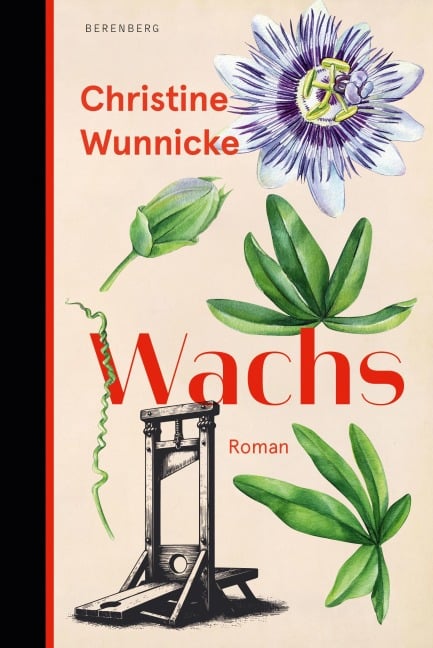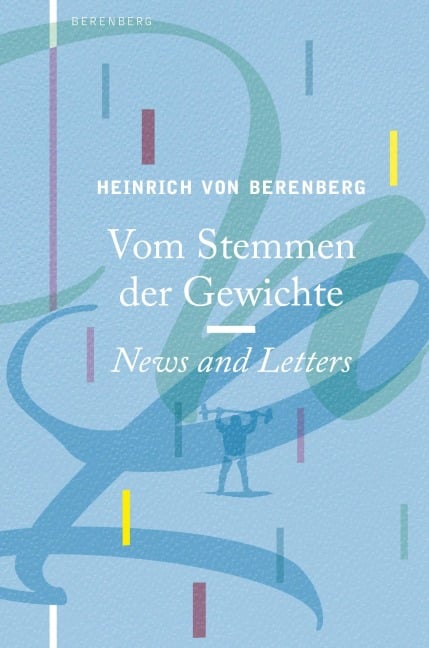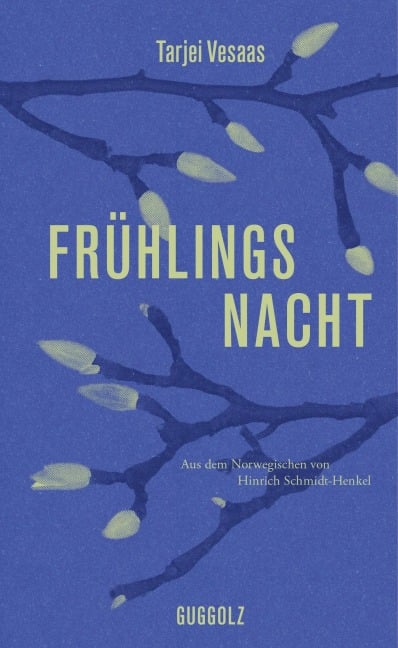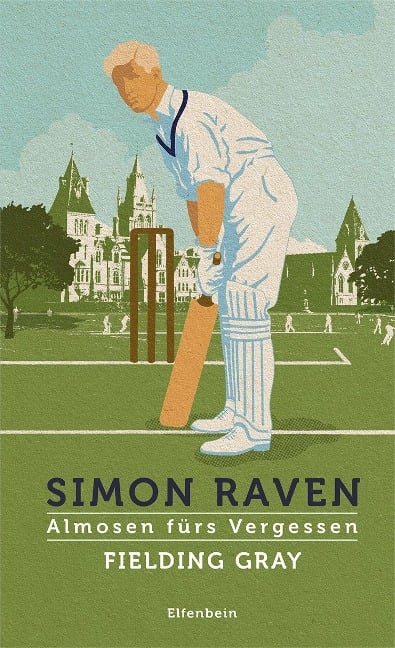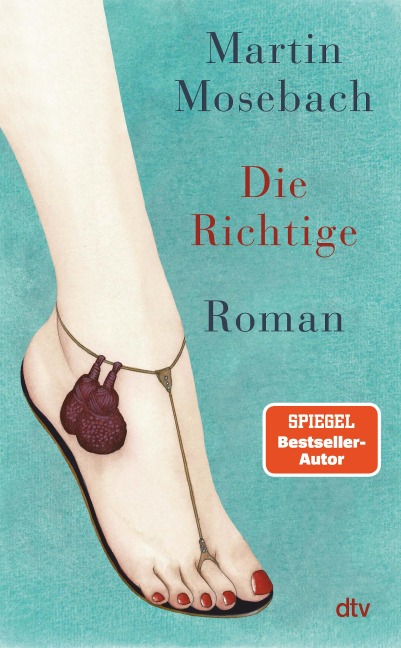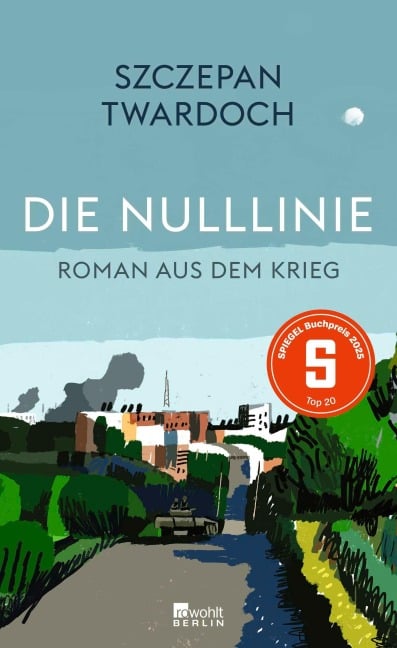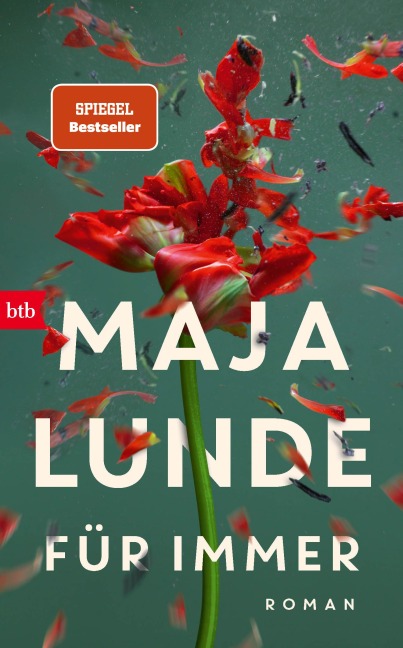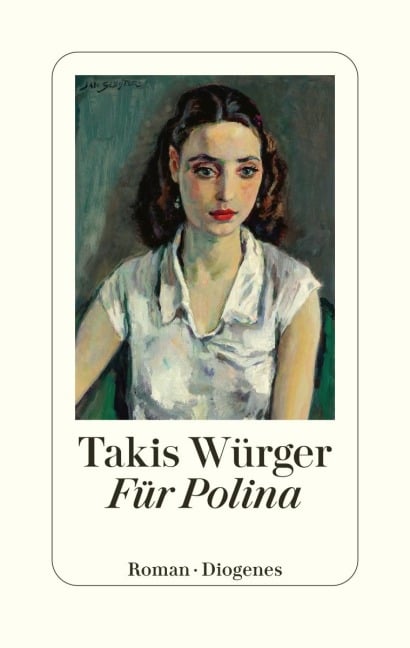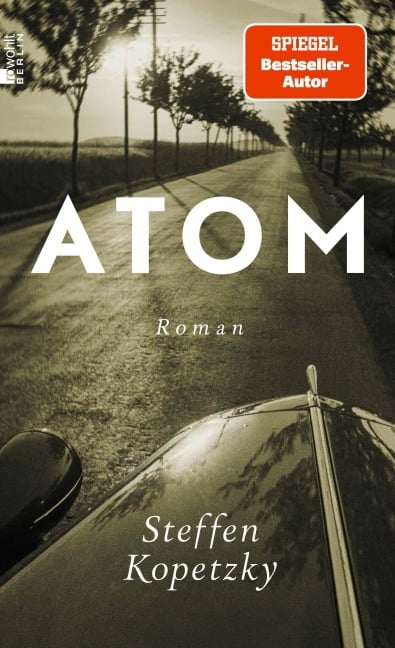Die Nulllinie Szczepan Twardoch
Buch (Hardcover)
Krieg, Kampf, das Dunkle im Menschen sind ein Lebensthema von Szczepan Twardoch, in all seinen Büchern. In den letzten zwei Jahren ist er als einziger westlicher Autor mehrmals mitten in den Krieg gereist, bis an die Nulllinie, die Front im Osten der Ukraine, war unterwegs mit Soldaten, Offizieren, einfachen Leuten wie Strategen. Er brachte Hilfslieferungen, sah das Sterben, war selbst in Gefahr.
In diesem so erzählerischen wie existenziellen Buch schreibt Twardoch über den Krieg, blickt zurück, erzählt von seinen Großvätern, die in den Weltkriegen kämpften, betrachtet das 20. Jahrhundert und denkt mit Thukydides nach über die Gewalt. Reich durch seine Erfahrungen wie Lektüren, durch seine Gespräche mit Menschen, für die es um alles geht, ist dieser vom Erleben gespeiste Text eine große Erzählung über das Menschliche an sich, über Leben und Freiheit, Tod und Mut. Um was lohnt es zu kämpfen? Und was macht der Krieg mit dem Menschen, seiner Seele?
Szczepan Twardoch hat einige große Romane veröffentlicht, die die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts zum Gegenstand haben („Der Boxer“, „Demut“, zuletzt 2024 „Kälte“). Sein neuer Roman „Die Nulllinie“ trägt den Untertitel "Roman aus dem Krieg". Der Krieg von dem hier die Rede ist, ist nicht historisch, er ist auch nicht beendet. Es geht um den Verteidigungskrieg der Ukraine gegen den russischen Angriff. Twardoch ist polnischer Staatsbürger, hat aber als Unterstützer vielfach Material an die ukrainische Front gebracht, er war mit Soldaten unterwegs und hat die Schrecken dieses Krieges aus der Nähe erfahren und sich dabei in Gefahr begeben.
Auch wenn man mit Anpreisungen in Klappentexten der Verlage vorsichtig sein muss, scheint es uns nicht zu hoch gegriffen, den Roman in eine Reihe mit den großen Kriegsromanen etwa von Remarque („Im Westen nichts Neues“) oder Hemingway („Wem die Stunde schlägt“) zu stellen. Dieser Roman wird bleiben und auch kommenden Generationen noch von der Wirklichkeit des Ukraine-Krieges erzählen.
Im Mittelpunkt der Erzählung steht ein polnischer Kriegsfreiwilliger, der sich Kon nennt und der zunächst als Drohnenpilot eingesetzt wurde, in der Erzählung aber als einfacher Soldat auf dem Ostufer des Flusses Dnipro („Unser Vater Dnipro“) in einem ukrainischen Brückenkopf kämpft. Die Haupthandlung des Romans umfasst nur eine kurze Zeitspanne von einigen Stunden und spielt auf wenigen Quadratmetern. Wir lernen eine überschaubare Anzahl von Kämpfern kennen, ihre persönlichen Geschichten und sehr unterschiedlichen Motivationen. Die Erzählung des Kriegsgeschehens ist hautnah. Wir befinden uns mit den Protagonisten in den Kellern zerstörter Häuser, wir erleben die Realität eines Kampfgeschehens, das wesentlich durch den Einsatz von Drohnen geprägt ist, die von den Soldaten teils privat finanziert werden müssen. Twardoch ist ein begnadeter Erzähler, der Rhythmus seiner Sprache und die literarischen Mittel sind seinem Stoff gewachsen. Die Erzählstimme schaut dem Protagonisten – einer Drohne gleich – von oben zu und ist zugleich seine eigene Stimme im inneren Dialog.
Twardoch stellt seiner Erzählung ein Motto aus der Ilias voran, in dem es – aus der Perspektive des Achill – um die Alternative zwischen Überleben und ewigem Nachruhm des gefallenen Kriegers geht.
"Aber wenn heim ich kehre zum lieben Lande der Väter;
dann sei verwelkt mein Ruhm, doch weithin reiche des Lebens
Dauer, und nicht frühzeitig ans Ziel des Todes gelang ich."
Zur literarisch-historischen Einordnung der Konfrontation zwischen der Großmacht Russland und der Ukraine bezieht sich Twardoch auf den berühmten Melier-Dialog, über den Thukydides in seinem „Peloponnesischen Krieg“ berichtet. Die Athener als die Stärkeren konfrontieren die Einwohner der Insel Melos, die im Krieg zwischen Athen und Sparta neutral bleiben wollen, mit der Forderung nach Unterwerfung und Beitritt zum athenischen Bündnis und argumentieren ausschließlich damit, dass sie die Stärkeren sind – so wie Putin vor dem Überfall auf die Ukraine dieser mit der Vernichtung drohte und die (vermeintliche) Unumgänglichkeit ihrer Unterwerfung betonte („Du wirst dich fügen müssen, meine Schöne“).
"Das ganze Problem des politischen Realismus der Schwächeren besteht darin, dass man wissen müsste, ob die Spartaner kommen. Nur kann man das nicht im Voraus wissen. Dass die Spartaner kommen werden, dass am Ende Hunderte von Panzern aus Polen in die Ukraine rollen, diese ganze große Hilfe, die sich auf der Autobahn 4 von Westen nach Osten wälzte, was du bei der Fahrt von Breslau nach Lemberg gesehen hast, diese Arterie des Krieges, angefüllt mit Containern und Lafetten, davon konnte man ja am Anfang keineswegs sicher ausgehen. Man weiß nie. Wie soll man politischer Realist sein im Nebel, im Chaos, in der Uneindeutigkeit? Rechtfertigt der spätere Erfolg das große Risiko?"
In der Realgeschichte des peloponnesischen Krieges sind die Spartaner den Meliern nicht zur Hilfe gekommen, alle Männer wurden nach der Verweigerung der Unterwerfung von den Athenern getötet und die Frauen und Kinder versklavt.
In einer Nachbemerkung erklärt Twardoch, dass „Die Nulllinie“ ein „Roman über den wirklichen Krieg“ sei, „jedoch sind die darin beschriebenen Personen und Ereignisse fiktiv; sie müssen es sein, damit ich diesen Krieg so nah an der Wahrheit beschreiben kann, wie ich es vermag.“
Im Gespräch mit Thomas Böhm (Radio 1 vom RBB) hat Twardoch auf die Frage, welche Wahrheit er meint, ausgeführt:
„Ich bin Romanautor. Ich arbeite also mit den Werkzeugen, die ich am besten kenne. Das war ein Grund, mich für die Form des Romans zu entscheiden. Der zweite ist, dass viele meiner Charaktere auf realen Personen basieren. Wenn ich Sachbücher schreiben würde, müsste ich bei der Beschreibung viel vorsichtiger sein. Um ihnen nicht zu schaden. Nicht nur den Russen, sondern auch den Menschen innerhalb des ukrainischen Militärs. Die Fiktion ist der Schutzwall, mit dem ich meine Freunde schütze. Die Menschen, die ich kenne und denen ich nur Gutes wünsche. Es gibt noch einen dritten Grund. Nämlich den, dass ich fest davon überzeugt bin, dass der Roman eine sehr wichtige Errungenschaft unserer Zivilisation ist. Wie die Quantenphysik oder die gotische Kathedrale. Der Roman ist eine Form, die es uns Schreibenden ermöglicht, das Leben wahrheitsgetreu zu beschreiben. Vielstimmig. Ein Roman kann das Leben in all seiner Vielfalt, Tiefe und Komplexität beschreiben. Sachbücher haben ihre Grenzen. In Sachbüchern kann man das Innenleben der Figuren nicht beschreiben, weil man es einfach nicht kennt. Man kann sich nicht ausmalen, was sie fühlen. In einem Roman sollte man genau das tun.“
Und wir können dankbar lesen, dass dieses wahrhaftige Erzählen Twardoch in grandioser Weise gelungen ist.
Angesprochen auf das Motto aus der Ilias und das Thema des soldatischen Ruhms berichtet Twardoch von den Ratuschni-Brüdern, die im Ukraine-Krieg gefallen sind, einer von ihnen ein „sehr junger Dichter und Aktivist, der seit 2014 kämpfte. Er fiel, glaube ich, letztes Jahr. Die ganze Nation trauerte nach seinem Tod. Seine Beerdigung in Kiew war eine Massenveranstaltung. Tausende Menschen kamen, um ihm die Ehre zu erweisen. Er hatte einen Bruder, der vor zwei Monaten starb. Zurück blieb die Mutter, die beide Söhne im Krieg verlor und nun die Hüterin ihrer Erinnerung ist. Ja, sie taten, was Achilles tat. Sie erlangten ewigen Ruhm, ewige Berühmtheit. Aber sie verloren ihr Leben, sie verloren die ganze Welt. Sie verloren die Möglichkeit zu lieben, Kinder zu haben, Gedichte zu schreiben, Künstler zu sein, einfach alles. Sie verloren alles, aber erlangten ewigen Ruhm. War es ihre Entscheidung? Ich weiß es nicht. Sie akzeptierten die Möglichkeit zu sterben. Sie haben sich nicht vor der Einberufung gedrückt, sondern sich freiwillig gemeldet, weil sie kämpfen wollten. Sie haben die Möglichkeit des Todes in Kauf genommen, ihr Leben zu verlieren, um ihr Land zu verteidigen. Ich schätze, es war eine Art Wahl. Und die Mutter? Natürlich ist es eine Tragödie, aber andererseits sagt sie: ‚Ich habe sie so erzogen.‘“
Und auf die Frage nach der Motivation der Soldaten, die er erlebt habe, führt Twardoch in dem Gespräch aus:
„Die meisten Soldaten, die ich getroffen habe, sind gegen den Krieg. Sie wollten ihn nicht. Sie kämpfen, weil sie müssen. Es ist nicht ihre Lebensart. Sie müssen diesen Krieg einfach führen, weil sie ein Land zu verteidigen haben. Und die Verteidigung des Landes ist keine abstrakte Idee. Es ist kein abstrakter Patriotismus. Denn sie verteidigen ganz reale und einfache Dinge, wie ihre Heimat. Sie verteidigen ihre Familie. Sie schützen ihre Familie vor Vergewaltigung, Mord und Massengrab. (…) Ich bin mir absolut sicher, dass die Motivation von Soldat zu Soldat unterschiedlich ist. Und die Motivation kann sich mit der Zeit ändern. Denn der erste Impuls könnte die Verteidigung des Landes sein. Dann will man kämpfen, weil man seine Freunde nicht im Stich lassen will. Denn gemeinsamer Kampf schafft eine starke Bindung zwischen Menschen. Und ich denke, diese Art von Bindung ist etwas ganz Besonderes im Krieg. Ich würde sagen, es ist eine brüderliche Bindung zwischen Menschen, die täglich dem Tod ins Auge sehen, der Möglichkeit des Todes. So kämpft man immer weiter, weil man seine Freunde, seine Brüder, seine Kameraden nicht im Stich lassen kann. Es tut mir leid, ich weiß, das klingt alles klischeehaft und vielleicht ein bisschen peinlich oder banal. Aber genau darum geht es.“
Nach der Lektüre dieses Romans wird man künftig bei der täglichen Zeitungs-Lektüre der Kriegsberichte an die Menschen denken, die im Abwehrkampf gegen den Aggressor ihre Köpfe hinhalten und ihr Leben riskieren müssen.
zum Produkt
€ 24,00*
 Und dann auf "Zum Home-Bildschirm [+]".
Und dann auf "Zum Home-Bildschirm [+]".