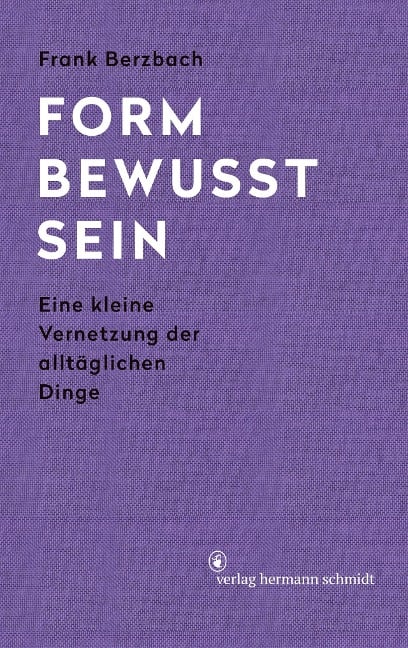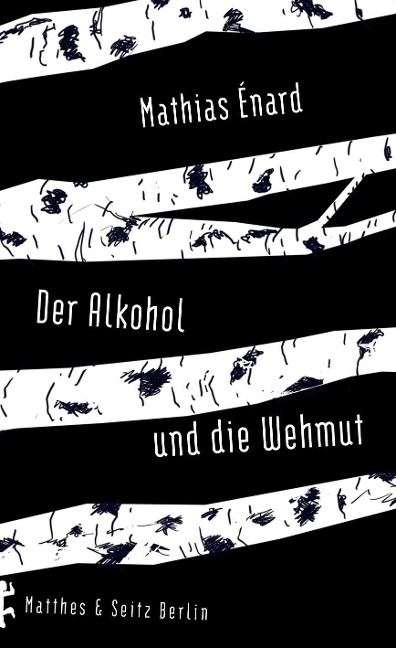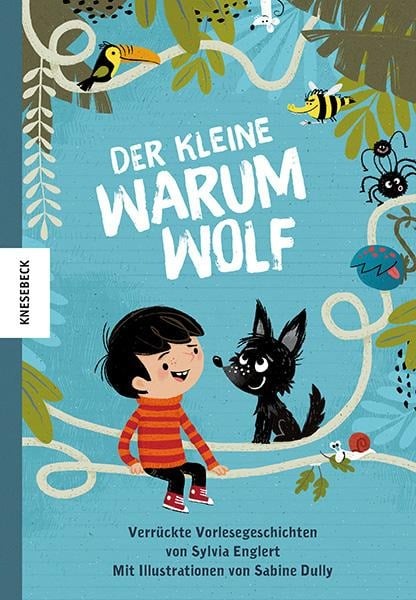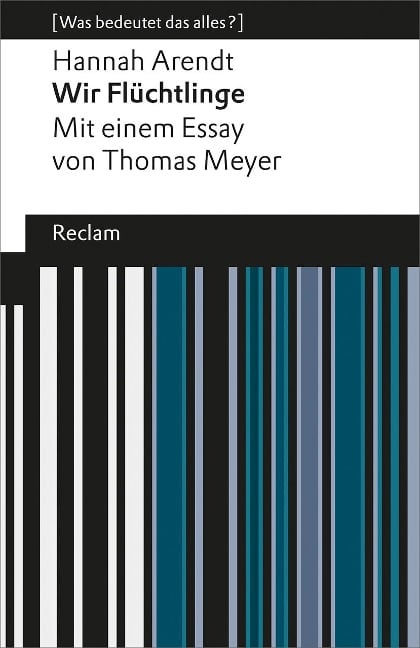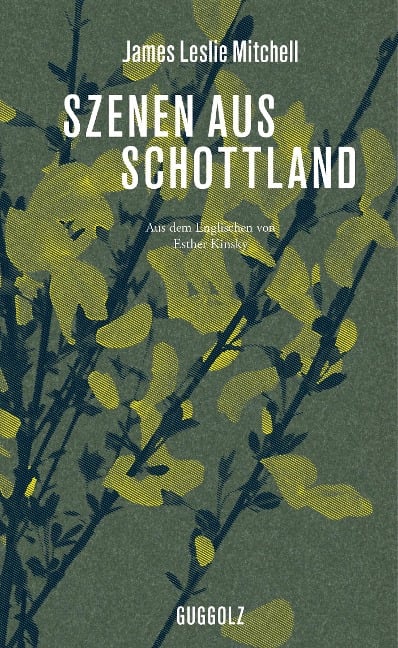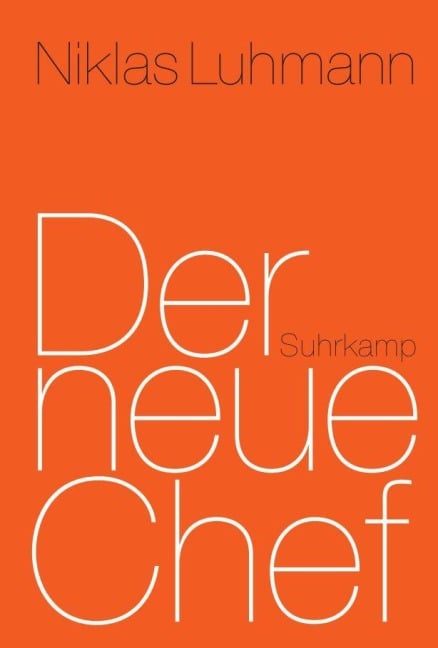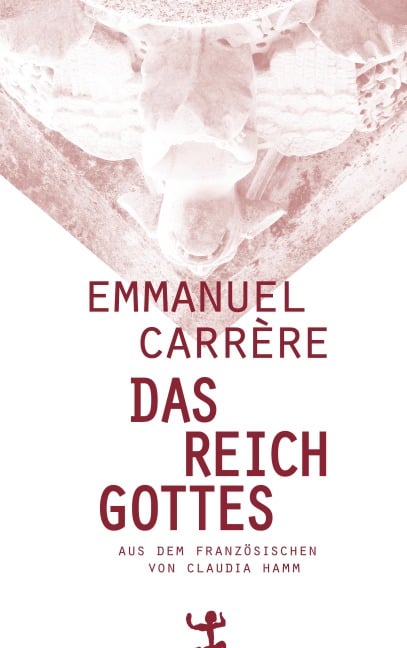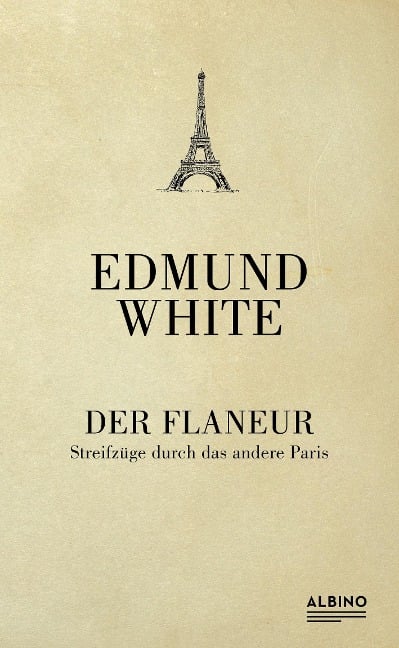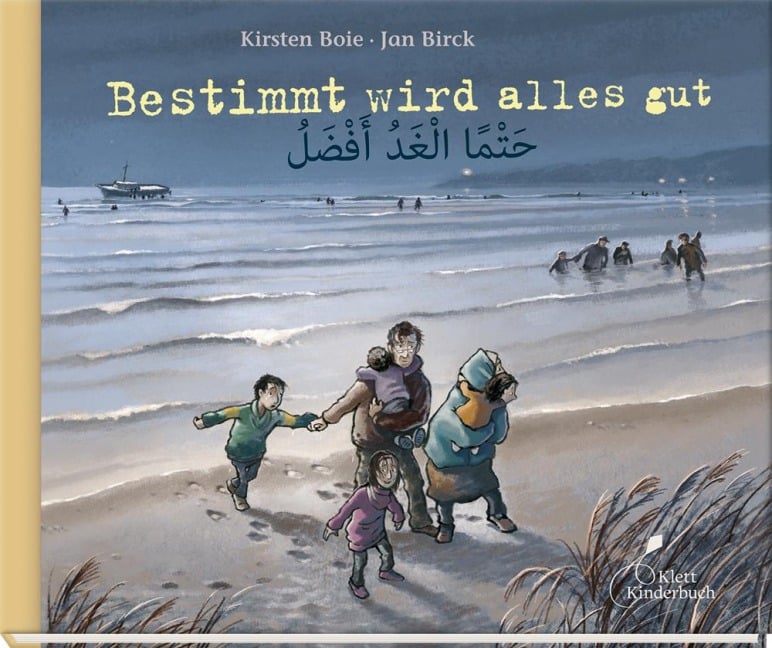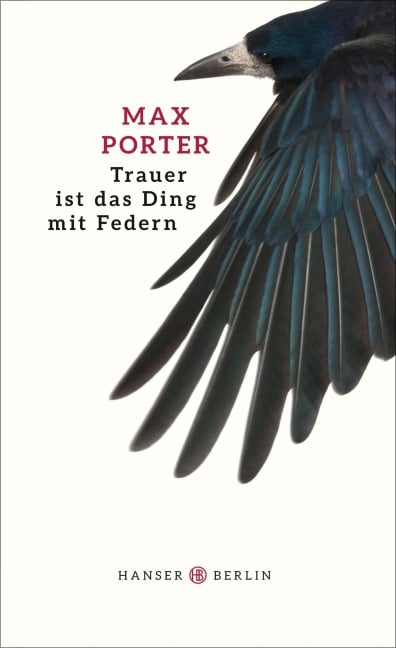Trauer ist das Ding mit Federn Max Porter
Buch (Hardcover)
Die Ausgangssituation: Eine junge Familie, Mutter, Vater und die Zwillingssöhne, Reihenhäuschen alles friedlich. Dann die Katastrophe: Die Mutter stürzt die Treppe hinunter, Hirnblutung, tot. Das ändert ALLES. Das Leben der drei Hinterbliebenen wird zur surrealen Bewährungsprobe, denn unbewusst war es stets die Mutter, die alles zusammenhält, nicht nur im Haushalt, sondern auch im seelischen Gleichgewicht der ganzen Familie.
In dieses emotionale Chaos hinein ertönt plötzlich ein Klingeln an der Tür, aber statt der erwarteten Freunde steht da eine riesige Krähe und verschafft sich Zutritt zum Haus. Sie läuft durch die Räume, verliert hier und da ihre schwarzen Federn („Auf deinem Kopfkissen liegt auch eine Feder.“) und spricht, krächzend zwar, aber verständlich:
„In anderen Versionen bin ich Arzt oder Geist. Ideale Vehikel: Ärzte, Geister und Krähen. Wir können Dinge, die andere Figuren nicht können, etwa Traurigkeit essen, Geheimnisse zuhüllen und dramatisch mit Sprache und Gott ringen. Ich war Freund, Vorwand, Deus ex Machina, Scherz, Symptom, Erfindung, Schrecken, Krücke, Spielzeug, Phantom, Gag, Analytiker, Babysitter.
Ich war schließlich ein zentraler Vogel… bis an die äußersten Grenzen. Ich bin Schablone. Ich weiß es. Ein Mythos, der manipuliert, der manipuliert wird.“
Mit dem Besuch der Krähe öffnet sich ein beeindruckender Kosmos. Die Referenz auf Poes Raben Nevermore ist offensichtlich. Der schwarze Vogel als Allegorie der Trauer, der erst geht, wenn der Schmerz überwunden ist. Der die Trauer frisst. Der Vogel weiß, dass er nur eine Metapher ist, aber das spielt keine Rolle, denn durch die Vogelfiktion wird ein unbegreifliches Gefühl greifbar, gegenständlicher und damit auch irgendwie händelbar. Und darum geht es in diesem Roman: wie gehe ich mit einer Situation um, die vollkommen überfordert, die im Skript meiner Vorstellungskraft bisher nicht vorhanden war, die weit über die Grenzen des Möglichkeitsinns hinausreicht? In dieser taumelnden Entrücktheit treffen sich die Wahrscheinlichkeiten vom Besuch einer sprechenden Krähe und das Sterben einer jungen Frau, Mutter, Geliebten, mit der man noch ein ganzes Leben geplant hatte.
Porters Roman ist nicht lang, aber auf den wenigen Seiten entfaltet er die ganze Kraft der Literatur. Metaphern können uns die Welt nicht nur erklären, sondern manchmal überhaupt erst erträglich machen. Aus diffusen Gefühlen werden so konkrete Bilder zu denen schließlich eine Distanz aufgebaut werden kann.
Sprachlich ist das brilliant umgesetzt, denn Porter (beziehungsweise seine genialen Übersetzer Uda Strätling und Matthias Göritz) beherrscht das lautmalerische Krächzen der Krähe ebenso wie den naiven Blick von sechsjährigen Jungen auf eine viel zu große Welt. Da werden souverän Perspektiven, Register, Zeitebenen gewechselt, um zu einem erstaunlich kohärenten Bild zu gelangen.
Nach der Lektüre bleibe ich zurück, zutiefst erschüttert von der Kraft dieser Prosa.
zum Produkt
€ 20,00*
 Und dann auf "Zum Home-Bildschirm [+]".
Und dann auf "Zum Home-Bildschirm [+]".